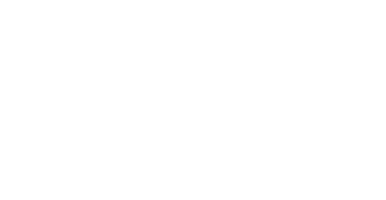Pflege zukunftsfähig gestalten: Für eine starke, gerechte und professionelle Pflege in Deutschland
Für den BochumerBund als gewerkschaftliche Vertretung für professionell Pflegende ist die Sicherung, Weiterentwicklung und Gestaltung einer zukunftsfähigen pflegerischen Versorgung der Bevölkerung von höchster Priorität. Die bisherigen politischen Bemühungen zeigen, dass die Bereitschaft zu Verbesserungen grundsätzlich vorhanden ist. Allerdings werden diese Maßnahmen oft verwässert oder in ihrer Ausgestaltung derart verändert, dass die ursprünglich angestrebten Ziele nur unzureichend oder gar nicht erreicht werden können. Einige Maßnahmen sind schlicht nicht ausreichend durchdacht und geplant.
Im Hinblick auf die gerade begonnene Legislatur war es dem BochumerBund wichtig eine Orientierung zu erstellen. Es ist von essenzieller Bedeutung, dass diese sowohl den Aspekt der Weiterentwicklung und Würdigung der professionellen Pflege als auch die moderne Ausrichtung des Pflegesystems in Deutschland beinhaltet. Nur so kann eine würdevolle und zeitgemäße Versorgung der Menschen mit Pflegebedarfen sichergestellt werden.
Akademisierung und Heilkundeausübung
In der Bundesrepublik Deutschland muss die Akademisierung der Pflegeberufe endlich als Chance auf eine moderne Ausrichtung der Aufgaben- und Verantwortungsteilung wahrgenommen werden. Es ist nicht zulässig, unbegründete Ängste als Argument zu verwenden. Mittelfristig muss ein größerer Anteil an Pflegefachpersonen mit akademischer Ausbildung das Ziel sein. Die nächste Bundesregierung hat die Aufgabe, die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten und den Erfolg der mit dem Pflegestudiumstärkungsgesetz bereits eingeführten Maßnahmen zu überprüfen. Im Dialog mit den entsprechenden Verbänden ist ein explizites Ziel für eine Akademisierungsquote bis zum Jahr 2035 zu definieren, an dem sich dann der Umfang der Aktivitäten orientieren kann. Gegebenenfalls können auch.
Staffellösungen entwickelt werden (2035/2040/2045). Sollten die Ziele in einem bestimmten Zeitraum nicht erreicht werden, sind entsprechende Schritte einzuleiten. Deutschland ist im internationalen Vergleich kein attraktiver Ort für Pflegefachpersonen mit akademischem Abschluss, was sich jedoch als Schlüssel zur internationalen Anwerbung von Pflegefachpersonen erweisen könnte. Dies erfordert eine konsequente Weiterentwicklung der Infrastruktur an Hochschulen und in den Einsatzgebieten. Zudem ist in den einzelnen Pflegesettings sicherzustellen, dass akademisch qualifizierte Pflegefachpersonen adäquate Arbeitsplätze in ausreichender Anzahl vorfinden. Für akademisierte Pflegefachpersonen sind attraktive tarifliche Lösungen zu finden. Um intraprofessionelle Diskurse hinsichtlich der Etablierung akademischer Pflegefachpersonen im Praxisfeld zu unterstützen, müssen klare Kompetenzverteilungsregelungen am besten bundeseinheitlich eingeführt werden.
Die Ausführung von Heilkunde muss letztlich von allen Pflegefachpersonen gewährleistet sein, wobei spezifische, mit Gefahren verbundene Heilkunde lediglich von entsprechend qualifizierten Pflegefachpersonen, das heißt akademisierten Pflegefachpersonen, vorgenommen werden darf. Die Verabschiedung des Pflegekompetenzgesetzes durch den Bundestag steht derzeit noch aus. Wir werden jedoch in Kürze eine Aktualisierung vornehmen. Es sei jedoch angemerkt, dass die Übertragung von heilkundlichen Aufgaben nicht ausschließlich auf Pflegefachpersonen mit akademischem Abschluss begrenzt werden darf. Die Kompetenzübertragung muss in der Breite wirken, weshalb darauf geachtet werden muss, welche Kompetenzen tatsächlich eine akademische Qualifikation erfordern und welche auch durch grundständig ausgebildete Pflegefachpersonen mit entsprechender Zusatzqualifikation ausgeübt werden können. Diese Kompetenzerweiterung muss auch in anderen Bereichen Wirkung zeigen, weshalb eine Begrenzung auf den Bereich des Sozialgesetzbuchs XI nicht akzeptabel ist. Es ist daher von eminenter Wichtigkeit, dass auch Kolleg*innen in klinischen Settings ihre erworbenen Kompetenzen eigenverantwortlich einsetzen können. Wir fordern daher eine zügige Verabschiedung eines Pflegekompetenzgesetzes sowie weiterer in diesem Zusammenhang bereits angedachter Gesetze (beispielsweise das APN-Gesetz).
Tarifliche Entwicklung
Die Entlohnung von professionell Pflegenden muss einer signifikanten Verbesserung unterzogen werden, um eine gerechte Entlohnung zu gewährleisten. Die pandemische Lage zu Beginn der 2020er Jahre hat die Dringlichkeit dieser Maßnahme deutlich gemacht. Seither wird wiederholt öffentlich die Behauptung aufgestellt, die Entlohnung sei nun auf einem angemessenen Niveau. Nach wie vor besteht jedoch ein signifikantes Delta zwischen einem angemessenen Gehalt und der tatsächlich tariflich festgelegten Entlohnung. Zwar stiegen die Gehälter in den letzten Jahren, allerdings vor dem Hintergrund von Inflation und den auch in anderen Bereichen gestiegenen Entlohnungen bei weitem nicht so stark, dass ein Sog in den Beruf ausgelöst wurde. Es gibt aber auch Sektoren, in denen nach wie vor schlechter bezahlt wird als es nach den geltenden Tarifverträgen üblich ist. Besonders problematisch ist die Situation in den Bereichen der Langzeitpflege und der ambulanten Pflege, wo es durch die Auslegung der “ortsüblichen” Entlohnung zu einer Umgehung der tariflichen Entlohnung kommt.
Die Anhebung des Mindestlohns trägt nicht dazu bei, die Schere zwischen diesem und der Entlohnung professionell Pflegender zu schließen. Die gesetzgebender Instanz wird aufgefordert, die bestehenden Schlupflöcher umgehend zu schließen und eine 100-prozentige Refinanzierung der tatsächlich anfallenden und durch Wirtschaftsprüfende bestätigten Personalkosten in der Langzeitpflege ohne weitere Verhandlung sicherzustellen.
Die aktuell (noch) verhandelnden Akteure und Akteurinnen im Bereich der Tarifverträge für professionell Pflegende auf Arbeitnehmerseite nutzen nicht alle von der gesetzgebenden Instanz geschaffenen Verhandlungsspielräume, um die tarifliche Entlohnung dieser Berufsgruppe auf ein angemessenes Niveau zu heben. Dies ist eine Achillesferse der Tarifautonomie, die es zu überwinden gilt. Aus diesem Grund wird professionell Pflegenden empfohlen, sich in einer auf ihre Belange spezialisierten Gewerkschaft zu organisieren. Historisch betrachtet haben sich solche Spartengewerkschaften als effektiv erwiesen, wie die Beispiele des Marburger Bundes im Gesundheitswesen oder anderer Spartengewerkschaften in diversen anderen Bereichen der Bundesrepublik zeigen. Von entscheidender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die angemessene Entlohnung akademisch ausgebildeter Pflegefachpersonen. Dies erfordert eine angemessene Kompensation für Studium, Tätigkeitsfeld und Verantwortung (Klammer Ute, Klenner Christina; Lillemaier Sarah 2018 «Comperable Worth» Arbeitsbewertung als blinder Fleck in der Ursachenanalyse des Gender Pay Gaps? WSI Study Nr.14).
Selbstverwaltung
Wir fordern die Politik dazu auf, endlich den nächsten Schritt zu gehen und eine flächendeckend organisierte Selbstverwaltung der Pflegefachpersonen in der Bundesrepublik Deutschland zu implementieren. Wir wissen, dass die Bemühungen zur Implementierung von Landespflegekammern in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und zuletzt in Baden-Württemberg gescheitert sind. Allerdings liegt das nicht an der Institution der Kammern, sondern an halbherzigen, unausgereiften oder schlecht aufgestellten Verfahren zur Errichtung von Pflegekammern. Man könnte sogar die provokante Frage stellen, ob man in Baden-Württemberg nicht mit einem unzureichenden Errichtungsverfahren absichtlich ein Scheitern provoziert hat. Die Implementierung einer auf Augenhöhe zwischen den einzelnen Berufsgruppen im Gesundheitswesen basierenden Zusammenarbeit setzt voraus, dass die Selbstverwaltung nicht nur einer Berufsgruppe, sondern allen Berufsgruppen im Gesundheitswesen ermöglicht wird. Dies kann nicht durch unausgereifte oder schlecht vorbereitete Befragungen gewährleistet werden, die es Berufsfremden erlauben, über Kammern abzustimmen. Es handelt sich hierbei um eine politische Entscheidung, die getroffen werden muss. Es geht in erster Linie nicht um die Anliegen der Berufsgruppe selbst, sondern um die Gewährleistung einer angemessenen Pflegeversorgung der Bevölkerung. Dies kann nur durch politische Gleichstellungen in den Bereichen Mitbestimmung, aktives und passives Wahlrecht in demokratischen Prozessen innerhalb der Selbstverwaltung des Gesundheits- und Pflegewesens sichergestellt werden. Die mangelnde Legitimation durch demokratische Wahlen verhindert, dass Hilfs-Konstrukte aus der Berufsgruppe heraus zu Selbstbestimmung führen. Vielmehr resultieren sie in Fremdbestimmung, die sich in finanzieller Abhängigkeit manifestiert oder zumindest in deren Verdacht steht.
Ausbildung in der Pflege
Die Qualität der pflegerischen Ausbildung in Deutschland ist von entscheidender Bedeutung,
um in Zukunft eine professionelle und zukunftsfähige Versorgung sicherzustellen. Die Reform
der Pflegeausbildung durch das Pflegeberufegesetz (PflBG) im Jahr 2020 stellt einen
entscheidenden Schritt dar, um die generalistische Ausbildung zu stärken und die beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten zu verbessern. Die empirische Evidenz zeigt jedoch, dass
signifikante Verbesserungen notwendig sind, um die Herausforderungen im Bildungssystem
nachhaltig zu bewältigen (BMG, 2022).
Berufsschulen und Ausbildungsstätten
Der Zustand der Berufsschulen und Ausbildungsstätten stellt eine zentrale Herausforderung dar. Viele Bildungseinrichtungen sind personell und materiell unzureichend ausgestattet. Dies muss sich ändern! Es ist evident, dass die Anzahl der Lehrkräfte mit pflegepädagogischem Hochschulabschluss bei Weitem nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken, was zu einer Überlastung der Lehrenden und einer erheblichen Beeinträchtigung der Qualität der Ausbildung führt.
Lernmittel und digitale Ausstattung
Die Bereitstellung adäquater Lernmittel sowie die Ausstattung mit digitalen Medien sind in der Pflegeausbildung nach wie vor unzureichend und bedürfen einer zeitnahen Verbesserung. Digitale Lernplattformen und interaktive Lehrmaterialien werden in unzureichender Zahl und zu eingeschränktem Umfang genutzt, wobei ländliche Regionen von einer digitalen Unterversorgung betroffen sind, was die Chancengleichheit für Auszubildende erheblich einschränkt. Dieser Zustand ist als inakzeptabel zu erachten und bedarf einer umgehenden Behebung.
Praxisanleitung und praktische Ausbildung
Die Praxisanleitung durch qualifizierte Pflegefachpersonen stellt einen elementaren Bestandteil der Pflegeausbildung dar und muss sichergestellt werden. Es ist jedoch offensichtlich, dass Praxisanleiter*innen in den meisten Fällen nicht freigestellt werden und durch ihre reguläre Arbeit in den Einrichtungen stark belastet sind. In der Konsequenz wird der gesetzlich vorgeschriebene Umfang der Praxisanleitung von mindestens zehn Prozent der praktischen Ausbildungszeit oft nicht erreicht (vgl. GKV-Spitzenverband, 2022).
Ausbildungsvergütung und finanzielle Anreize
Die Implementierung einer bundesweit einheitlichen Ausbildungsvergütung stellt einen bedeutenden Schritt zur Verbesserung der finanziellen Situation der Auszubildenden dar. Nichtsdestotrotz bestehen nach wie vor regionale und sektorale Disparitäten, die es zu beseitigen gilt. Die Vergütung in der Langzeitpflege muss signifikant erhöht werden, um eine Angleichung an die tariflichen Standards anderer Sektoren des Gesundheitswesens zu gewährleisten.
Zugangsvoraussetzungen und Durchlässigkeit
Die Implementierung einer bundesweit einheitlichen Ausbildungsvergütung stellt einen
bedeutenden Schritt zur Verbesserung der finanziellen Situation der Auszubildenden dar.
Nichtsdestotrotz bestehen nach wie vor regionale und sektorale Disparitäten, die es zu
beseitigen gilt. Die Vergütung in der Langzeitpflege muss signifikant erhöht werden, um eine
Angleichung an die tariflichen Standards anderer Sektoren des Gesundheitswesens zu
gewährleisten.
Zugangsvoraussetzungen und Durchlässigkeit
Die Zugangsvoraussetzungen zur Pflegeausbildung wurden durch das PflBG flexibilisiert, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Allerdings bestehen weiterhin Hürden, insbesondere für Personen mit ausländischen Bildungsabschlüssen. Anerkennungsverfahren und Sprachprüfungen sind häufig komplex und langwierig, was eine Integration internationaler Fachpersonen behindert.
Primärqualifizierende Studiengänge und deren Finanzierung
Die Implementierung primärqualifizierender Studiengänge im Pflegebereich stellt eine signifikante Weichenstellung zur Professionalisierung des Berufsbildes dar. Diese Studiengänge sind gemäß dem Pflegeberufegesetz (PflBG) und der Pflegeberufe-Ausbildungs-und Prüfungsverordnung (PflAPrV) geregelt und ermöglichen den Erwerb einer pflegerischen Berufszulassung sowie eines akademischen Abschlusses. Trotz dieser richtungsweisenden Reform bestehen in Deutschland erhebliche strukturelle und finanzielle Defizite, die einer erfolgreichen Umsetzung entgegenstehen. Diese Defizite müssen dringend beseitigt werden, um die Reform erfolgreich umsetzen zu können und den Studierenden eine faire Chance im internationalen Vergleich zu bieten. Die Finanzierung dieser Studiengänge stellt einen zentralen Schwachpunkt dar. In Deutschland wird die Ausbildung an Berufsschulen durch öffentliche Mittel subventioniert, während die Finanzierung primärqualifizierender Studiengänge oft in den Zuständigkeitsbereich der Hochschulen und Länder fällt. Dies resultiert in einer unzulänglichen Finanzausstattung, welche dazu führt, dass Studiengänge nicht flächendeckend etabliert werden können und Hochschulen nur begrenzte Aufnahmekapazitäten schaffen.
Infrastruktur der Hochschulen
Die Kapazitäten an Hochschulen, die primärqualifizierende Studiengänge anbieten, sind in Deutschland unzureichend. Die Hochschulen kämpfen mit einer ungenügenden personellen und technischen Ausstattung. Es mangelt insbesondere an qualifizierten Lehrpersonen, die über einen akademischen Abschluss und einschlägige Praxiserfahrung verfügen. Die Kapazitäten an Hochschulen, die primärqualifizierende Studiengänge anbieten, sind in Deutschland begrenzt. Es ist inakzeptabel, dass Studienplätze oft auf wenige Hundert pro Jahr egrenzt sind. Dies ist dem Bedarf der pflegerischen Versorgung nicht ansatzweise gerecht. Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland schlecht ab. Es ist an der Zeit, dass Deutschland nachzieht und endlich primärqualifizierende Studiengänge in der Pflege flächendeckend etabliert. In skandinavischen Ländern, den Niederlanden und Großbritannien gehören sie längst zum Standard im Gesundheitswesen.
Anerkennung und berufliche Perspektiven
Für Absolvent*innen primärqualifizierender Studiengänge sind angemessene Perspektiven von essenzieller Bedeutung. Die Tatsache, dass trotz gestiegener Anforderungen tarifliche Regelungen für akademisch qualifizierte Pflegefachpersonen unzureichend definiert sind, ist inakzeptabel. In zahlreichen Einrichtungen existieren keine klaren Stellenprofile und keine angemessene Entlohnung, die die akademische Qualifikation widerspiegelt. Diese Situation muss dringend verbessert werden!
Personalschlüssel
Die Regierungen der vergangenen Jahre haben sich mit großem Engagement für die Verbesserung der in sämtlichen pflegerischen Kontexten unzulänglichen Personalschlüssel eingesetzt. Dies war dringend notwendig, da die Situation bereits seit Langem als äußerst problematisch zu betrachten ist. Die vorgenommenen Verbesserungen erweisen sich jedoch als unzureichend und werden durch einen eklatanten Mangel an qualifizierten Pflegefachkräften bzw. ausgebildeten Pflegeassistent*innen zusätzlich verschärft.
In der stationären Langzeitpflege wurde ein Personalbemessungssystem festgelegt, das einen geringeren Fachkraftanteil im Personalmix vorsieht. Das Instrument der Personalbemessung in der Pflege (PeBem) hat eindeutig gezeigt, dass es in den Einrichtungen der Langzeitpflege einen enormen Bedarf an Mehrpersonalisierung gibt. Es besteht dringender Bedarf an qualifizierten Pflegeassistent*innen, die in der hohen Zahl bisher nicht ausgebildet und vorhanden sind, was sich auch nicht so schnell ändern wird. Dennoch wurden an zahlreichen Stellen frühere Mindeststandards für erforderliche Fachkräfte bereits abgeschafft, herabgesetzt oder nicht konsequent genug kontrolliert.
Wir fordern, die bestehenden gesetzlichen Regelungen zu Fachkraftquoten so lange beizubehalten, bis das neue System zur Personalbemessung in der Breite tatsächlich mit dem gebotenen und evidenzbasierten Qualifizierungsniveau eingeführt wurde.
In der ambulanten Pflege ist die Implementierung eines evidenzbasierten Personalbemessungssystems dringend erforderlich. Die Festlegung der Minutenwerte erfolgt nach wie vor auf Basis einer unzureichenden Honorierung pflegerischer Leistungen, was zu einem inakzeptablen Arbeitsdruck für die Kolleg*innen in den Touren führt. Wir fordern die unverzügliche Beauftragung und Einführung eines evidenzbasierten Personalbemessungssystems.
In den Kliniken befindet sich aktuell die PPR 2.0 in der Erprobungsphase, wobei es sich um eine Weiterentwicklung eines Systems handelt, welches in den Kliniken bereits seit fast 40 Jahren existiert, bislang jedoch keinerlei Konsequenzen nach sich gezogen hat und über keine wissenschaftliche Basis verfügt. Wir raten dringend davon ab, sich auf dieses bisher erfolglose System zu verlassen. Die neu eingeführte Erfassung ist nicht ausreichend und nicht wissenschaftlich fundiert. Zudem wird sich die Umsetzung im aktuellen Mangel kaum realisieren lassen.
Wir fordern die Entwicklung einer wissenschaftlich evaluierten Personalbemessung und werden es nicht zulassen, dass Assistenzleistungen für Pflegefachpersonen unberücksichtigt bleiben. Letztlich muss es einen strengen Sanktionskatalog geben, um zu vermeiden, dass Klinikträger sich von ihrer Verantwortung “freikaufen” ‣‣‣Tarifliche Entwicklung. Die Entlastung des Pflegepersonals darf nicht durch Zuschläge, die an Akkordarbeit erinnern, beeinträchtigt werden. Eine angemessene Bezahlung ist nur dann möglich, wenn Schichten unterbesetzt oder überlastet sind. Das ohnehin zu geringe Gehalt darf nicht weiter geschmälert werden. Völlig unterbesetzte Schichten können nicht durch wenige zusätzliche freie Tage ausgeglichen werden. Das Resultat aus jeder Form von festgelegter Personalbemessung muss zwingend eine Leistungskürzung bei Unterschreitung sein, wobei auch die Patientensicherheit, die durch Unterbesetzungen hoch gefährdet ist, sichergestellt werden muss.
Tätigkeitsprofile
Die Tätigkeitsprofile von Pflegefachpersonen in Deutschland entsprechen im Skill-Mix nicht dem internationalen Niveau. Eine kurze Recherche zeigt, dass Pflegefachpersonen im internationalen Vergleich nicht nur aufgrund der bisher schlechten Personalausstattung unter hohem Arbeitsdruck stehen. Die bisherigen Anforderungen an Pflegeassistenz sind unzureichend – sowohl qualitativ als auch quantitativ. Dies resultiert in einer Überbelastung der Pflegefachpersonen mit Tätigkeiten, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Maßnahmen, wie die Ausgliederung der Pflegefachpersonen aus den Fallpauschalen, führen bereits jetzt dazu, dass Kliniken Pflegeassistenten entlassen und Tätigkeiten ohne besondere Qualifikationsanforderungen wieder zu Pflegefachpersonen verschoben werden. Die Regelungen der Vorhaltefinanzierung für Krankenhäuser nach dem neuen Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz werden sich durch wirtschaftliche Fehlanreize ebenfalls negativ auf die Besetzung mit Pflegefachpersonen auswirken. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, zeitnah für die Festlegung von Pflegekompetenzen im Klinikbereich zu sorgen und somit ein Tätigkeitsprofil zu realisieren, das der hochwertigen Ausbildung der Pflegefachkräfte entspricht.
Es wird gefordert, alle pflegerischen Leistungen aus den Fallpauschalen herauszulösen und dauerhaft abzusichern. Das Pflegebudget ist neben dem Vorhaltebudget und den Residual-DRG als dritte Säule wieder einzuführen. Zudem ist eine Ausweitung der Pflegekompetenzfestlegung auf den Klinikbereich erforderlich. Die Steuerung des gesamten Pflegeprozesses und die daraus resultierenden Maßnahmen sind und bleiben originäre Pflegetätigkeiten. Sie müssen deshalb zwingend als solche festgeschrieben werden.
Die Vollfinanzierung pflegerischer Leistungen ist das angemessene Mittel, um die dringend erforderlichen Entwicklungen in Bezug auf Quantität, Qualität und Vergütung zu ermöglichen. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass jede pflegerische Leistung in einem neuen Sozialgesetzbuch festgelegt wird. Die Vermischung von Pflegeleistung und Laienleistung hat in den letzten 40 Jahren zu einem unklaren Verständnis von professioneller Pflege geführt, für die das Sozialgesetzbuch XI verantwortlich ist und inzwischen das Verständnis der gesamten Bevölkerung. Solange Pflegeleistungen Marktgesetzen unterworfen sind, können sie ihr volles Potential für die Gesellschaft nicht entfalten. Die bisherige Finanzierungsstruktur verhindert im Bereich der ambulanten und stationären Langzeitpflege jegliche personelle oder tarifliche Verbesserung und damit eine bessere Versorgung der Menschen mit Pflegebedarf. Dies führt insbesondere im ambulanten Sektor häufig zu Leistungskürzungen und einer Verschlechterung der pflegerischen Versorgung. Das SGB XI muss dahingehend geändert werden, dass das Ausspielen von Laienpflege und professioneller Pflege endlich ein Ende hat. Im Krankenhaus müssen alle pflegerischen Leistungen aus den Fallpauschalen herausgenommen werden ‣‣‣ Tätigkeitsprofile.
Aufhebung der Sektorengrenzen
Zu den größten Herausforderungen in der Gesundheits- und Pflegeversorgung zählen nach wie vor die bestehenden Sektorengrenzen. Sie sind die Ursache für Versorgungsbrüche, die auf unterschiedlichen Finanzierungssystemen und einer nur geringen gesetzlichen Verpflichtung zur intersektoralen Zusammenarbeit beruhen. Wir fordern die Einführung gesetzlicher Regelungen, die eine sektorübergreifende Zusammenarbeit verpflichtend machen und jedem Leistungserbringer hierfür persönlich bzw. institutionell die Erfolgsverantwortung zuschreiben. Daneben empfehlen wir die Überprüfung der Etablierung sektorübergreifender Budgets, um die Versorgungsperspektive nicht schon an finanziellen “Grenzen” scheitern zu lassen.
Es ist von entscheidender Bedeutung, die Festlegung und Begrenzung von Risikoprämien für Pflegeunternehmen zu etablieren. Die Berichterstattung über die hohen Gewinnmargen in der Pflegebranche steht in deutlichem Kontrast zu den zahlreichen Einrichtungen, die über nicht ausreichend vorhandenes Risikokapital verfügen, um Engpässe oder notwendige Investitionen in die Zukunft zu gewährleisten. Es wird dringend empfohlen, eine gesetzlich festgelegte Prämie für das Risiko der Unternehmen in der Pflegebranche einzuführen, die für alle Betriebe, unabhängig von ihrer Trägerschaft, gelten muss. Es ist essenziell, dass die
Gewinnerzielung ausgeschlossen wird und die Prämie in der Höhe dem unternehmerischen Risiko angemessen ist. Um Anreize für eine gute Pflegequalität zu schaffen, sollte sich diese Prämie an Belegungstagen oder der Anzahl der Einsätze orientieren.