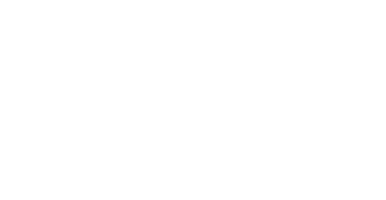Professionalisierung durch Struktur: Ein Blick nach Großbritannien – Interview mit Sabine Torgler
24.06.2025 – Das Interview zwischen Sabine Torgler, Registered Nurse in Großbritannien, und Jens Witt, Pressesprecher des BochumerBund, beleuchtet eindrucksvoll die berufspolitischen Strukturen der beruflichen Pflege im Vereinigten Königreich – und was Deutschland daraus lernen kann. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie gelingt es, berufliche Pflege als starke, eigenständige Profession zu etablieren?
Sabine Torgler lebt seit über 20 Jahren in Großbritannien. Sie ist dort registriertes Mitglied im Nursing and Midwifery Council (NMC) sowie im Royal College of Nursing (RCN). Diese beiden Institutionen bilden das Fundament der professionellen Selbstorganisation der beruflichen Pflege im Vereinigten Königreich. Der NMC fungiert als Pflegekammer für England, Schottland, Wales und Nordirland. Ohne die dortige Registrierung ist eine Berufsausübung nicht möglich. Ergänzt wird dieses System durch das RCN, das als Berufsgewerkschaft weit mehr ist als ein klassischer Tarifpartner: Es ist politische Stimme, Bildungsanbieter und professionelle Heimat.
Diese klare institutionelle Verankerung verleiht der beruflichen Pflege Gewicht. „Wir haben seit über 100 Jahren eine Kammer und eine starke Gewerkschaft – das prägt“, erklärt Fr. Torgler. Das NMC schützt nicht nur die Berufsgruppe, sondern vor allem die Gesellschaft. Die zentrale Aufgabe: sicherstellen, dass berufliche Pflege auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse stattfindet. Das bedeutet für alle Registrierten auch Verpflichtung: Fortbildung, Reflexion, Verantwortungsübernahme. Der alle drei Jahre durchzuführende Revalidations-Prozess ist dafür ein zentraler Baustein. Jede Pflegefachperson muss nachweisen, dass sie ihre berufliche Praxis reflektiert, sich kontinuierlich fortbildet und auf dem aktuellen Stand der Pflegewissenschaft ist.
Was nach bürokratischem Aufwand klingt, ist für Fr. Torgler ein Zeichen von Professionalität: „Das stärkt unseren Anspruch, auf Augenhöhe mit anderen Gesundheitsberufen zu agieren.“ In Großbritannien ist es selbstverständlich, dass berufliche Pflege eigenständige Entscheidungen trifft, im multiprofessionellen Team mitredet und wissenschaftlich fundierte Beurteilungen abgibt. Berufsbilder wie die Advanced Nurse Practitioner (ANP), die über Diagnose- und Verschreibungsrecht verfügen, unterstreichen das. Ebenso Programme wie das Preceptorship – eine strukturierte Begleitung für frisch graduierte Pflegefachpersonen – sorgen für einen stabilen Berufseinstieg.
„Pflege ist bei uns nicht einfach ein Job. Sie ist eine Profession mit Rechten, Pflichten und Stolz“, fasst Fr. Torgler zusammen. Dabei ist klar: Wer mitreden will, muss sich organisieren. Die gewerkschaftliche Durchdringung ist hoch – rund 95 Prozent der beruflich Pflegenden sind Mitglied im RCN oder einer anderen Gewerkschaft wie Unison. Daraus ergibt sich eine Schlagkraft, die in Deutschland fehlt. „Ohne Organisation keine Stimme – ohne Stimme keine Veränderung“, lautet Torglers klares Credo.
Ein weiterer zentraler Punkt: Fort- und Weiterbildung sind nicht Sache des Arbeitgebers, sondern Ausdruck eigener Professionalität. In Großbritannien ist lifelong learning Teil der Pflegekultur. Mindestens 21 Fortbildungen pro Jahr sind Standard – davon ein Teil in der Freizeit. Torgler sieht das als Investition in die Qualität der Versorgung und in die eigene berufliche Entwicklung. Der Zugang zu einer großen Fachbibliothek über das RCN, Online-Ressourcen und Kongresse unterstützt dies. „Es geht nicht darum, ob man Zeit hat – sondern ob man sich Zeit nimmt.“
Auf die Frage, wie Deutschland im Vergleich dasteht, antwortet Torgler deutlich: „Die berufliche Pflege in Deutschland ist keine Profession – noch nicht.“ Es fehle an Kammerstrukturen, an flächendeckender Akademisierung und an starker gewerkschaftlicher Organisation. Auch fehle vielfach das berufliche Selbstverständnis: „Pflege ist mehr als ein Handwerk – sie ist wissensbasiert, reflektiert und eigenverantwortlich. Aber das muss man auch leben wollen.“
Dabei ist die Entwicklung in Deutschland nicht nur negativ. Großveranstaltungen wie der Hauptstadtkongress, erste Studiengänge für Community Health Nurses oder der Aufbau einer Bundeskammer zeigen Bewegung. Doch Torgler warnt vor Halbherzigkeit: „Es reicht nicht, Begriffe zu übernehmen. Es braucht Struktur, Haltung und Kontinuität.“ Viele der Konzepte – etwa das Manchester-Triage-System oder ANP-Modelle – würden in Deutschland zwar eingeführt, aber nicht mit der notwendigen Tiefe und Systematik. „Wer nur das Etikett übernimmt, ohne die Philosophie dahinter zu verstehen, verfehlt das Ziel.“
Der demografische Wandel, der internationale Wettbewerb um Fachkräfte und die steigenden Anforderungen in der Patientenversorgung machen ein Umdenken zwingend notwendig. In Großbritannien wurde berufliche Pflege nach der Covid-Pandemie öffentlich sichtbarer und attraktiver – Bewerberzahlen stiegen, neue Studienplätze wurden geschaffen. Deutschland könnte diesen Effekt ebenfalls nutzen – wenn es gelingt, Pflege nicht nur in der Krise zu würdigen, sondern strukturell zu stärken.
Torglers Wunsch an die deutschen Kolleg:innen ist klar: „Werdet Mitglied! Unterstützt Kammer und Gewerkschaft. Nur so bekommt ihr Mitsprache, Anerkennung und Perspektiven.“ Die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen dürfe nicht unorganisiert bleiben. „Wer sich nicht beteiligt, akzeptiert den Status quo – und verliert jede Verhandlungsmacht.“
Das Interview ist ein leidenschaftliches Plädoyer für mehr Eigenverantwortung, für politische Teilhabe und für das Selbstverständnis als Profession. Es zeigt eindrucksvoll: Die berufliche Pflege kann stark sein – wenn sie sich organisiert, reflektiert und weiterentwickelt. Der Blick nach Großbritannien ist damit keine Utopie, sondern ein realistischer Wegweiser für eine professionellere Pflege in Deutschland.